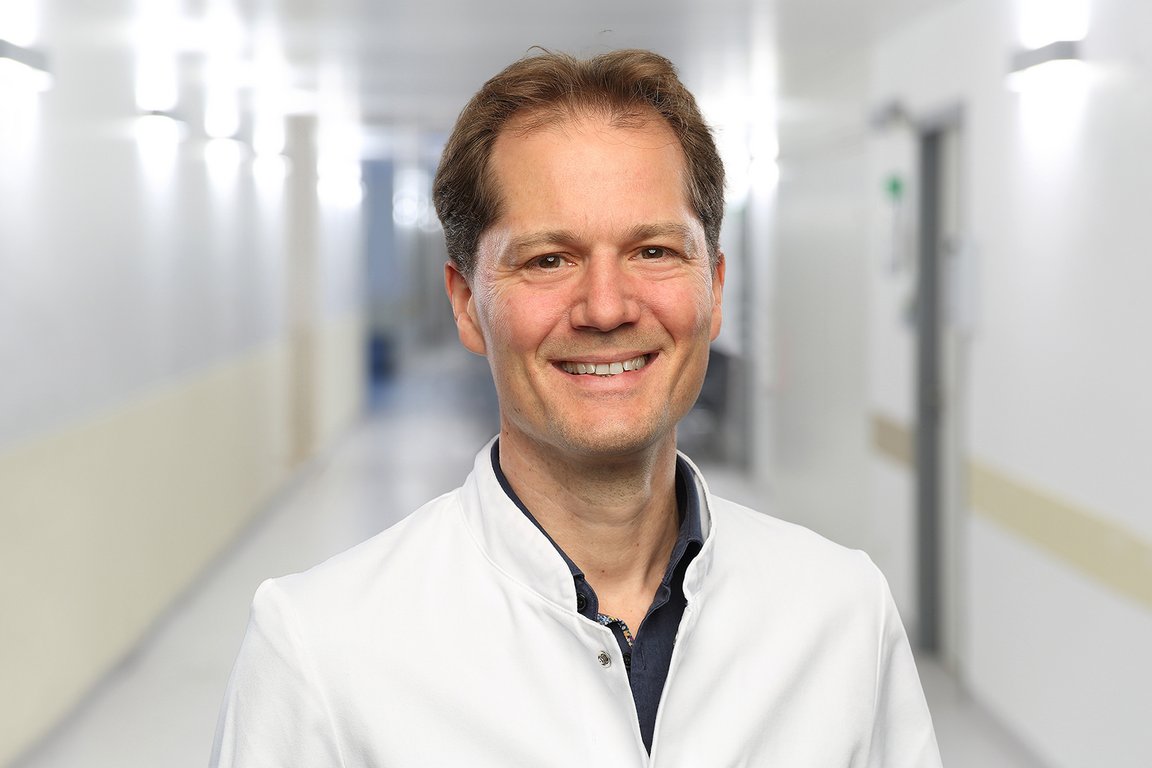Darmkrebs lässt sich erfolgreich therapieren – durch die bestmögliche Kombination aus Operation, Bestrahlung, Chemotherapie und Nachsorge.
Umfang und Zeitplan der Behandlung sind abhängig von
- der Art der Erkrankung (Dickdarm- oder Enddarmkarzinom)
- dem Stadium der Erkrankung
- der Zahl der betroffenen Lymphknoten
- eventuell betroffenen anderen Organen
Bei Dickdarmkrebs steht die operative Entfernung des betroffenen tumortragenden Darmabschnitts inkl. der dazugehörigen Lymphknoten im Vordergrund. In den meisten Fällen können die Darmenden wieder aneinandergefügt werden. Ein künstlicher Darmausgang ist bei diesen Operationen nur selten erforderlich.
Prinzipiell begünstigt die Anwendung minimal-invasiver Techniken (Schlüssellochchirurgie) die rasche Genesung. Die Langzeitergebnisse unterscheiden sich nicht von klassischen Operationsverfahren. Das Darmzentrum am SJK setzt die Schlüssellochchirurgie ein, wann immer sie medizinisch sinnvoll ist.
Das gilt auch für Operationen bei Tumorerkrankungen des Darmes direkt oberhalb des Schließmuskels. Dieser Bereich ist für die Chirurginnen und Chirurgen schlecht einsehbar, weshalb bisher ein großer Bauchschnitt medizinischer Standard war. Inzwischen ist es jedoch möglich, auch hier minimal-invasiv vorzugehen. Bei dieser Operation, die Ärzte sprechen von transanaler TME (Totale Mesorektale Excision), wird das Tumorgewebe unter endoskopischer Sicht durch den intakten Schließmuskel hindurch entfernt. Die klinische Anwendung dieser Methode startete im St. Joseph Krankenhaus vor eineinhalb Jahren, erste Ergebnisse sind vielversprechend. Frühestens in drei Jahren liegen Langzeitergebnisse zu Tumorfreiheit und Lebenserwartung der Patienten vor; zwischenzeitlich nimmt das Darmzentrums am SJK an mehreren Studien teil.
Früher Beginn von Bestrahlungen
Seit rund 20 Jahren erfolgt bei Enddarmkrebs, abhängig von der Ausdehnung des Tumors zum Zeitpunkt der Erstdiagnose, eine Bestrahlung des Tumors bereits vor der Operation. Mit Röntgenstrahlen lassen sich Tumore zerstören bzw. verkleinern. Besonders bei größeren Enddarmtumoren oder wenn diese sehr nah am After liegen, ist eine Bestrahlung vor der Operation empfehlenswert – in der Regel begleitet von einer Chemotherapie zur Verstärkung des Behandlungserfolgs. Die Strahlentherapie vor der Operation schädigt die Tumorzellen so stark, dass sie nicht mehr die Fähigkeit haben, einen neuen Tumor zu bilden, selbst wenn einige Tumorzellen bei der Operation nicht zu entfernen sind. Sie werden durch die Strahlentherapie nach der Operation bekämpft.
Zum Zeitpunkt des bestätigten Verdachts auf Darmkrebs kann der Tumor bereits Krebszellen durch die Lymph- und Blutgefäße in andere Organe des Körpers gestreut haben. Die Krebszellen wachsen dann vor Ort, z.B. in Leber und Lunge, und bilden sogenannte Metastasen aus. Durch die rasche Weiterentwicklung der Behandlungsmöglichkeiten, können wir heutzutage auch bei Vorliegen von Metastasen durch individuelle multimodale Therapiekonzepte mit Kombination aus medikamentöser Tumortherapie, Chirurgie und interventionellen Verfahren (z.B. Thermoablation) den Tumor erfolgreich behandeln.
Bestehen bei weit fortgeschrittenem Darmkrebs aus medizinischer Sicht keine Heilungschancen mehr, kann eine lindernde palliative Operation die Lebensqualität verbessern und die Lebenserwartung erhöhen.
Intensive Nachsorge und Betreuung notwendig
Alle Einzelheiten rund um Operation und Nachsorge werde ausführlich besprochen, auf Wunsch auch mit deren Angehörigen. Die Nachsorge ist besonders wichtig, um eventuell neu aufgetretene Tumore, Metastasen oder begleitende Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und gezielt zu therapieren. Diese wird in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen durchgeführt. Während der Nachsorge-Darmspiegelung können wiederkehrende Darmpolypen direkt entfernt und somit ein wiederholtes Krebswachstum verhindert werden.
Eine Krebserkrankung empfinden viele Menschen als sehr belastend. Der psychoonkologische Dienst, Stomatherpeuten und Ernährungsberater des St. Joseph Krankenhauses überlegen gemeinsam mit den Patienten, welche Hilfe in Anspruch genommen werden sollte.